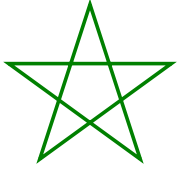
Die Welt der Krebspatienten
Lawrence
LeShan:
„Psychotherapie gegen Krebs. Über die Bedeutung emotionaler
Faktoren bei der Entstehung
und Heilung von Krebs“
(You Can Fight for Your Life: Emotional Factors in the Treatment of
Cancer 1977)
Kapitel:
Die Welt der Krebspatienten. Seite 169 – 186.
Klett-Cotta 2001

Wie
in diesem Buch immer wieder gesagt worden ist, lebt der
todkranke Krebspatient in einer
besonderen Welt, und dies im physischen wie im psychischen Sinne. Sein
innerer Werdegang unterscheidet ihn ganz deutlich von den Menschen,
die ein viel beschäftigter Therapeut in seiner großstädtischen Praxis
üblicherweise empfängt. Mit den herkömmlichen psychotherapeutischen
Techniken ist ihm nicht zu helfen; vielmehr bedarf es neuer Methoden,
nämlich der
Krisentherapie, um diesen
Patienten aus der engen Welt zu befreien, und ihn wieder zum „Kampf“
um sein Leben zu befähigen.
Wie es einer Patientin oder einem Patienten wirklich geht, sagt nicht
die Diagnose aus.
Obwohl es etliche Patienten gibt, die erst
aufgrund der Diagnose sagen können,
wie es ihnen geht. Auf der
anderen Seite soll es auch Ärzte geben,
die einem Patienten erst
glauben, wenn eine Diagnose feststeht.
Ärzte
sollen nicht bloß vordergründige Diagnosen behandeln,
sondern den
lebendigen "kranken" Menschen.
Nicht mehr Medizin am Objekt der Krankheit,
sondern Medizin am
Patienten mit seiner Krankheit.
Karl
Kraus war seiner Zeit voraus, als er meinte:
Die
verbreitetste
Krankheit
ist
die
Diagnose
Karl Kraus
(28. April 1874 in Jicín, Böhmen (damals Österreich-Ungarn,
heute Tschechien) - 12. Juni 1936 in Wien)
War einer der bedeutendsten
österreichischen Schriftsteller des beginnenden 20. Jahrhunderts,
ein Publizist, Satiriker, Lyriker, Aphoristiker, Dramatiker, Förderer
junger Autoren, Sprach- und Kulturkritiker –
vor
allem ein scharfer Kritiker der Presse und des Hetzjournalismus oder,
wie er selbst es ausdrückte, der Journaille.
Außer
mit seinen ganz speziellen psychischen Schwierigkeiten muss der
Krebspatient oft auch noch mit dem
chronischen Schmerz fertig werden. Es gibt erstaunlich wenig
Veröffentlichungen über die Situation des ständig schmerzgeplagten
Menschen.
In einem
der wenigen ernstzunehmenden Bücher über diesen Gegenstand sagt
[Frederick ] Buytendjick [1887-1974]:
„Der moderne Mensch betrachtet
den Schmerz nur als eine unangenehme Tatsache, um deren Beseitigung er
sich – wie um die Beseitigung jedes anderen Übels auch – nach Kräften
zu bemühen hat. Dazu bedarf es nach verbreiteter Meinung nicht erst
der Reflexion über die Erscheinung als solche.“
Aber
wenn man dem Patienten helfen will, seinen
Lebenswillen wieder zu finden, dann muss man sich auch mit
diesem Aspekt seiner besonderen Welt wirklich vertraut machen.
Die
Welt eines Patienten, der ständig von
Schmerzen geplagt ist, gleicht mehr oder weniger einem
Angsttraum. Der Angsttraum enthält
drei grundlegende Komponenten:
1. Es werden uns schreckliche Dinge angetan und noch schlimmere
angedroht;
2. die
Situation ist völlig unter der Kontrolle irgend-welcher äußeren
Mächte, und unser Wille kann nichts ausrichten;
3. es gibt keine
zeitlichen Begrenzungen, und wir können nicht voraussagen, wann die
Sache vorüber sein wird.
Der
Schmerzgeplagte Mensch ist im
Grunde in der gleichen Situation. Wenn man begreift, dass der
Krebspatient sich gewissermaßen ständig und bei vollem Bewusstsein in
einem Alptraum befindet, und wenn man ihm deutlich zeigt, dass man das
weiß, dann hilft ihm das oft, den „Angriff des Schmerzes“ auszuhalten.
Unter
Schmerz verstehen wir im Allgemeinen den
akuten und vorübergehenden Schmerz
– also das Zahnweh oder die durch Verbrennung, Schnitt, Prellung oder
Quetschung verursachte Schmerz-empfindung. Diese Art Schmerz wird sehr
rasch durch das Nervensystem hindurchgeleitet, sie ver-anlasst uns,
Gegenreflexe ins Spiel zu bringen, und sie geht gewöhnlich relativ
schnell vorbei. Wir sind von klein auf daran gewöhnt, solche Schmerzen
als ein nützliches und segenreiches Signal anzusehen.
Wenn nun
ein Mensch chronische Schmerzen
hat, dann versucht er es zunächst mit verallgemein-ernden Schlüssen
aus seiner Erfahrung mit dem akuten vorübergehenden Schmerz. Solche
Ver-allgemeinerungen sind aber sehr unzulänglich; tatsächlich bewirken
sie so gut wie nichts.
Wenn wir
chronische Schmerzen als ein
„Warnzeichen“ betrachten, werden die Dinge nämlich nur noch
unübersichtlicher. Denn wir erfahren ja nicht, was wir tun sollen, und
verfügen nicht über irgendwelche Gegenreflexe, die wir dem chronischen
Schmerz entgegensetzen könnten. Der Schmerz hält an, auch nachdem wir
uns in die Obhut eines Arztes begeben haben.
Er
fördert unser Handeln nicht, ja er kann so heftig sein, dass er uns
auch am Vollzug von Aktivitäten und Gewohnheiten hindert, die im
Grunde nützlich für uns wären. Chronischer Schmerz ist nichts als eine
Form des Dahinvegetierens.
Damit erscheint uns dieser Schmerz nicht
nur unerklärlich, sondern auch sinnlos.
Wenn wir
seelisch leiden, so ist dies die erklärbare Folge unserer Gedanken und
Handlungen; seelisches Leid spiegelt unsere Sicht unserer selbst.
Aber chronischer physischer Schmerz ist
uns fremd und unverständlich. Offensichtlich ergibt er sich
nicht aus dem, was wir sind oder getan haben. Wir können keinen Sinn
in ihm entdecken; aber da es sehr schwierig ist, reale Erfahrungen als
unsinnig und unvernünftig hinzunehmen, versuchen wir, dem Schmerz eine
Bedeutung zu geben.
Alte
Schuld- und Angstgefühle stehen von neuem in uns auf, und wir bemühen
uns, unsere Schmerzen mit diesen unzureichenden Gründen zu verknüpfen.
Alle großen Religionen und philosophischen Entwürfe haben versucht,
den Sinn des Schmerzes zu ergründen – aber in der modernen
anti-metaphysisch eingestellten Gesellschaft wird er weitgehend
ignoriert.
Schmerz
ist etwas, vor dem wir am liebsten die Augen verschließen – und
deshalb fehlt uns, wenn wir ihn doch einmal ertragen müssen, jede
Übung im Umgang mit ihm.
Als
Menschen versuchen wir in der Regel, mit dem, was uns umgibt, in
Kontakt zu kommen. Aber mit dem Schmerz können wir nicht in eine
Beziehung treten; wir können ihn nur ertragen. „Der
Mensch ist so beschaffen“, sagt Viktor Frankl [1905-1997], „dass
er nur leben kann, indem er seinen Blick in die Zukunft richtet“.
Aber
wenn ein Mensch chronische Schmerzen erleiden muss, geht ihm das
Gefühl für die Zeit verloren, er ist an
das unmittelbare Jetzt der Schmerzempfindung gekettet. Dazu
kommt, dass chronischer Schmerz in völliger Isolation empfunden wird.
Der
französische Schriftsteller Alphonse Daudet [1840-1897] sagt:
„Schmerz ist eine immer neue
Erfahrung für den, der ihn erleidet, aber banal für die Menschen in
seiner Umgebung. Sie alle werden sich daran gewöhnen – nur ich selbst
nicht.“
Die
laute Einsamkeit des Schmerzes treibt den Patienten mithin in die
psychische Regression [be-/unbewusster Rückgriff auf kindliche
Verhaltensmuster]. Seine Würde und sein hart erkämpfter Status als
erwachsener Mensch geraten in Wanken. Sein Bild von seinem Körper
verwischt sich; der Schmerz hebt sein übriges physisches Selbst
gewissermaßen auf.
Nur der
eine Bereich ist ihm bewusst, der solche überwältigenden Sensationen
hervorbringt. Aus seinem komplexen „erwachsenen“ Körperbewusstsein
wird der Mensch in eine eher kindgemäße Körper-vorstellung
zurückgeworfen. Dieser Verlust seines
Selbstgefühls als erwachsener Mensch wird noch durch den
Umstand verschärft, dass er jetzt wieder – wie damals als Kind – auf
andere Menschen angewiesen ist, die wichtige Dinge, die sein Leben
betreffen, für ihn zu entscheiden und zu erledigen haben.
Was die
Schmerzerfahrung des Krebspatienten
angeht, so steht sie häufig in einem Zusammenhang mit seiner
Lebenseinstellung insgesamt. Gotthard Booth [1899-1975] sagt dazu:
„Das Schmerzerleben hat häufig
mehr mit der moralischen als mit der physischen Verfassung des
Patienten zu tun.“
Dieses
Phänomen ist allen Menschen aus bestimmten Situationen bekannt – so
etwa dem Fußballspieler, der den Schmerz, welcher durch den eben
erlittenen Bruch verursacht ist, nicht spürt und einfach weiterspielt.
Schmerz existiert nicht losgelöst von der Tätigkeit des
Zentralnervensystems, und von der Verarbeitung und Integration des
Schmerzes durch dieses System hängt die Schmerz-wahrnehmung durch den
betroffenen Menschen und seine Fähigkeit ab, dem Schmerz Widerpart zu
bieten.
[Lew
Nikolajewitsch] Tolstois [1828-1910] Novelle
„Der Tod des Iwan Iljitsch“
[1886] enthält eine fas-zinierende Schilderung von der Reaktion eines
krebskranken Menschen auf den Schmerz.
In
diesem Werk, das vor rund einem Jahrhundert entstanden ist, wird mit
großer Genauigkeit und ungewöhnlichem Verständnis die Lebensgeschichte
eines Menschen erzählt, die uns in nahezu jeder Hinsicht an den
Werdegang und das „Profil“ der krebsanfälligen Persönlichkeit
erinnert, wie sie hier gezeichnet worden sind. Tolstois Geschichte
gehört zu den nicht eben seltenen Beispielen dafür, dass der Künstler
„eher da war“, nämlich lange vor dem Forscher.
Iwan
Iljitsch wird erst in dem Augenblick vom Schmerz überwältigt, in dem
er die absolute Sinnlosigkeit seines Lebens erkennt.
Solange er der Meinung ist, sein Dasein habe einen Sinn, kann er dem
Schmerz widerstehen und sich seine Würde und Selbstbeherrschung
bewahren.
Eine
Bekannte von mir, die wegen einer Erkrankung des Innenohrs seit vielen
Jahren heftige Schmerzen auszuhalten hatte, setzte ihr rühriges,
sinnvolles und bewegtes Leben dennoch mit unvermindertem Elan fort.
Auf die Frage, wie sie das mache, antwortete sie: „Wenn
der Schmerz besonders schlimm wird, dann erhebe ich mich über ihn und
sehe von oben her auf ihn herab.“
Diese
Erklärung sollte nicht einfach als „hysteroid“ abgetan werden. Diese
Frau war imstande, ihre Selbstbeherrschung zu wahren und den Schmerz,
den sie empfand, unter Kontrolle zu halten, und deshalb wurde sie
nicht von ihm überwältigt.
Im
Allgemeinen sind Krebspatienten
von dem Augenblick an, in dem sie ihr
immer zurückgewiesenes wahres Selbst wieder entdecken und
einen Sinn in ihrem Leben erkennen,
eher imstande, mit ihren Schmerzen fertig zu werden.
Eine
meiner Patientinnen, deren Verfassung sich im Laufe der Therapie
erheblich besserte, sagte mir:
„Es ist so ähnlich wie mit dem Unterschied zwischen Geburts- und
anderen Schmerzen. Wenn man in den Wehen liegt, dann weiß man, dass am
Ende im wahrsten Sinn des Wortes „etwas dabei herauskommt“. Das ist
niemals so schlimm, wie wenn der Schmerz überhaupt nichts erbringt.“
Wenn man
dem krebskranken Patienten helfen möchte, mit seinen Schmerzen fertig
zu werden, dann muss man sich zunächst wiederum auf den
individuellen Menschen
konzentrieren, den man vor sich hat. Dafür kann es keine feste Regeln
geben; man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass diese
Konzentration auf das Individuum
wichtig ist. Wir müssen dem Patienten helfen, diejenige Lösung zu
finden, die gerade ihm am besten entspricht und seiner Sicht der Dinge
am ehesten gerecht wird, nicht aber eine Lösung, wie sie dem
Therapeuten vielleicht einleuchten würde.
"Die Hauptaufgabe des Arztes besteht darin, günstige Bedingungen zu
schaffen,
so dass die natürlichen Kräfte im Körper zu Harmonie gelangen
und ihn wieder gesunden lassen
…
Abgesehen davon, dass niemand bei Krebs ein Heilungsversprechen
abgeben kann,
weil die Prognose wegen des völlig individuellen Verlaufes immer
ungewiss bleibt,
sollte es eigentlich einem jeden, der nicht absolut böswillig und
damit
keiner Argumentation zugänglich ist, deutlich sein,
dass bei diesen schweren Krankheitsbildern, mit denen
meine Patienten zu mir kamen, ein von vornherein
gegebenes "Versprechen" einer Heilung
geradezu absurd wäre."
Dr.med. Josef Issels: "Mein Kampf gegen den Krebs - Erinnerungen eines
Arztes"
Seite 299, 160, Ullstein Sachbuch 1983 (1981)
Manche
Patienten schaffen es, ihrem Schmerz einen Sinn zu geben, und zwar im
Zusammenhang mit dem neuen Verständnis ihrer selbst, das die Krankheit
ihnen eingetragen hat. „Dein
Schmerz“, sagt Kahlil Gibran [1883-1931] in „Der Prophet“ [1923],
„ist das Zerbrechen der Hülle,
die dein Verständnis umschlossen hat.“
Einem
Patienten, der es immer vermieden hat, seinem wahren Selbst zu
begegnen, der immer gefürchtet hat, dass die Menschen ihn nicht lieben
würden, wenn er ihnen dieses Selbst enthüllen würde, leuchtet unter
Umständen die Überlegung ein, dass sein Krebs ihn an einen Punkt
gebracht hat, an dem er entweder sich selbst bereitwillig annehmen
oder aber sterben muss. Die Entdeckung, dass er als
„er selbst“ geliebt werden kann,
macht ihm den Schmerz erträglich, und mit seiner neu gewonnenen Kraft
kann er ihm nun auch Widerpart bieten.
Andere
Patienten werden mit ihrem Schmerz wieder in anderer Weise fertig. Die
Erkenntnis, dass die Erfahrung ihrer Krankheit ihnen niemals verloren
gehen kann und dass sie nach einer solchen Erfahrung nichts mehr zu
fürchten haben, lässt sie möglicherweise mit [Friedrich] Nietzsche
[1844-1900] sagen: „Was mich
nicht tötet, macht mich stark.“
Wieder
andere betrachten den Schmerz, den sie empfinden, als
existent in sich; dass
gerade sie ihn empfinden,
bedeutet für sie, dass dadurch einem anderen Menschen diese Erfahrung
erspart geblieben ist.
Wie
erfolgreich der Therapeut ist, hängt also weitgehend von seinem
Einfallsreichtum ab, wenn es darum geht, dem Patienten zu helfen, die
für ihn beste und günstigste Lösung zu finden. Wenn der
Lebenswille sich wieder
stabilisiert, dann empfinden viele Patienten etwas, das [Fjodor]
Dostojewski [1821-1881] in die dunklen und weisen Worte gekleidet hat:
„Es gibt nur eines, das ich
fürchte: meiner Schmerzen nicht würdig zu sein.“
Wenn der Schmerz ungewöhnlich stark oder ungewöhnlich resistent ist,
dann sollte man sich fragen, ob im Falle dieses bestimmten Patienten
vielleicht ein besonderer Zweck dahinter steht.
Hält der Schmerz vielleicht Schuldgefühle von ihm fern?
Vermittelt er
dem Patienten das Gefühl, „vorhanden“ zu sein, das er so dringend
braucht?
Enthält er eine Botschaft?
Starker Schmerz kann zum Beispiel
stellvertretend für überwältigende seelische Qualen sein.
In der
medizinischen Literatur wird von Fällen berichtet, in denen die
chronischen Schmerzen des Patienten durch Medikament oder andere
Maßnahmen gelindert wurden und es unmittelbar anschließ-end zu einem
seelischen Zusammenbruch oder dem Selbstmord des Patienten kam.
Unsere
kulturell bedingte Orientierung gegenüber dem Schmerz – dass er
nämlich schlimm und böse sei und umgehend gelindert werden müsse – ist
nun einmal so stark ausgeprägt, dass uns oft gar nicht der Gedanke
kommt, der Patient wolle uns durch seine Schmerzen vielleicht eine
Botschaft zukommen lassen.
Gerade im Fall von Krebspatienten muss der Therapeut besonders auf der
Hut sein, wenn der Schmerz ungewöhnlich stark ist.
Der typische schwerkranke Krebspatient hat sich nämlich schon vor der
Ent-stehung seines bösartigen Leidens jahrelang mit seelischen Nöten
herumgeschlagen. Es ist durchaus möglich, dass
der Krebs sich nicht nur
deshalb entwickelt hat, weil der Widerstand von Seiten des betroffenen
Menschen gering war - weil er nämlich seine gesamte psychische Energie
dazu einsetzen musste, sich vor seinen seelischen Nöten zu schützen -,
sondern auch deshalb, weil er
als eine Art physischer Stellvertreter für das unerträglich gewordene
psychische Leiden fungiert.
Das ist
zwar nur eine Vermutung, aber wir müssen sie doch als mögliche
Realität anerkennen und in solchen Fällen das psychische Leiden
linden, bevor wir den Patienten mit einiger Aussicht auf Erfolg von
seinen physischen Schmerzen befreien können, die - für ihn - leichter
zu ertragen sind als die Verzweif-lung, mit der er nun schon so lange
lebt.
Krebs ist genau wie die meisten Krankheiten
ein Symbol dafür, dass
im Leben des
Patienten
etwas nicht stimmt,
es ist eine Warnung für Ihn,
einen anderen Weg
einzuschlagen
Dr. Elida Evans
Psychologin aus der Jungschen Schule.
“A
Psychological Study of Cancer“
1926
"Die der Jungschen Richtung angehörende Forscherin untersuchte 100
Krebspatienten und entdeckte,
dass viele von Ihnen vor Ausbruch der Erkrankung einen Menschen
verloren hatten, der für Sie
von
großer emotionaler Bedeutung war und zu dem sie eine tiefe Beziehung
eingegangen waren.
Diese
Patientinnen (meinte Sie) hatten sich, anstatt die eigene
Individualität zu entwickeln,
mit
einem Objekt oder einer bestimmten Rolle (einer Person, dem Haus, in
dem sie wohnten,
ihrem
Beruf usw.) restlos identifiziert. Waren das Objekt oder die Rolle
gefährdet oder
verschwanden sie aus ihrem Leben, waren diese Patienten plötzlich auf
sich selbst
angewiesen und verfügten dabei nur über geringe innere Kraftreserven,
um mit
dieser Situation fertig zu werden
…“
Aus:
Gerald Pohler (b.1953, Österreichischer Psychotherapeut, klinischer
Psychologe): „Krebs und seelischer Konflikt.
Psychosoziale
Krebsforschung“ 2. Die Krebspersönlichkeit aus tiefenpsychologischer
Sicht. 2.4. Die Theorie der Grundstörung
[Michael Balint
(1896-1970)] bei Krebskranken. Seite 34. NEXUS 1989
Unabhängig davon, wie der einzelne Patient seine Schmerzen wahrnimmt,
ist Mitleid mit dem
Schmerz-geplagten Menschen in höchstem
Maße zerstörerisch. Wenn er bemerkt, dass man ihn bemitleidet,
dann schwächt dies seine Fähigkeit, mit den Dingen fertig zu werden.
Mitleid verstärkt das Gefühl der
Hilflosigkeit, denn es deutet an, dass er sich in einer
schlechteren Lage befindet als der, der ihn bemitleidet.
Man kann
die Anstrengungen, die der Patient unternimmt, um sich seine Würde und
seinen Status als erwachsener Mensch zu bewahren, durch
Empathie, durch
die emotionale Verbundenheit mit ihm
und den Respekt vor ihm unterstützen.
Mitleid dagegen schwächt nur seinen Lebenswillen,
und das muss nicht nur dem Therapeuten klar sein, sondern er muss es
auch der Familie des Patienten verständlich machen. Aus diesem und
anderen Gründen ist es sehr wichtig, dass der Therapeut Kontakt auch
zu den Angehörigen aufnimmt und diesen Kontakt aufrechterhält.
Da der
Patient in der Regel in seiner Familie lebt und Teil seiner Familie
ist, muss die Therapie auch diesen Aspekt der
Welt des Krebskranken
berücksichtigen. Nach der herkömmlichen therapeutischen Doktrin soll
der Kontakt des Therapeuten mit der Familie auf ein Mindestmaß
beschränkt sein, aber die Krisentherapie kann sich dieser Forderung
nicht anschließen. Wenn Patient und Therapeut einander ehrlich und
rückhaltlos begegnen, dann braucht der Therapeut nicht zu befürchten,
dass sein Kontakt mit der Familie in den Augen des Patienten einen Akt
der Illoyalität darstellt. Zudem sind die Themen, um die es geht, zu
wichtig – es handelt sich ja buchstäblich um eine Frage von Leben und
Tod -, als dass man irgendwelchen hergebrachten Regeln oder Gebräuchen
viel Beachtung schenken wollte oder könnte.
Die Familie bestimmt in nahezu jeder Hinsicht den Lebensraum des
Patienten.
Sie ist Teil seiner Realität und lässt sich nicht ignorieren. Mein
Patient Stanley, der ja bereits eine traditionelle
psychotherapeut-ische Behandlung hinter sich hatte, sagte einmal zu
mir: „Eben das ist nun mal die
Realitä!“ Der Thera-peut, der mit todkranken Krebspatienten
umgeht, muss diese Realität also voll in Betracht ziehen.
Der
Therapeut hat mehrere wichtige Gründe, sich mit dem Ehepartner –
und/oder den Kindern – des Patienten bekannt zu machen. Zunächst
einmal würden die Dinge, die er von der Familie erfährt, in den
Sitzungen mit dem Patienten vielleicht sehr lange gar nicht zu Sprache
kommen.
Und wenn
der Lebenswille des Patienten wieder geweckt werden soll, dann muss
das rasch geschehen – Zeit gehört nicht zu den Dingen, mit denen man
in der Krisentherapie ganz selbstverständlich rechnen kann. Die Zeit
muss hier in Wochen und Monaten gemessen werden, nicht in Jahren.
Sodann
ist es wichtig, dass man den Patienten so weit wie möglich von allem
zusätzlichen Druck befreit. Seine Familie kann in vielfältiger Form
Druck auf den Patienten ausüben, der ihm dann oft sehr zu schaffen
macht: an erster Stelle mit der für den Patienten sehr wohl
erkennbaren Erwartung, dass er der
gleiche Mensch bleibt, der er im Leben und Zusammenleben dieser
Familie immer gewesen ist.
Wenn man
der Familie begreiflich machen kann, dass
der Patient sich ändern
muss, damit er überhaupt um sein Leben „kämpfen“ kann, und dass
diese Änderung und Entfaltung
nicht das Ende ihrer Bezieh-ung zu ihm ist, sondern
diese Beziehung in der Regel eher festigt,
dann bleibt dem Patienten eine große Belastung erspart.
Wenn der
Gedanke an eine solche Veränderung beim Ehepartner des Patienten
übertriebene oder unangebrachte Befürchtungen auslöst, dann sollte der
Therapeut das wissen, weil ihm dann die Schwierigkeiten des Patienten
häufig gleich sehr viel verständlicher werden.
Oft ist die Familie mit den Ärzten der Meinung, dass der Zustand des
Patienten hoffnungslos sei und dass er wohl nur noch ein paar Monate
zu leben habe.
Wir
haben an mehreren Fallgeschichten in diesem Buch aber gesehen, dass es
entgegen der Meinung der Ärzte
durchaus zur Remission kommen kann [1], wenn der Patient im
erforderlichen Maß motiviert ist, für sein Leben zu kämpfen, und alle
seine Kräfte und Möglichkeiten in diesen „Kampf“ wirft.
Aber
auch wenn der Patient nicht „geheilt“ werden kann, wenn er es eben
nicht schafft, so lange gegen den Krebs anzukämpfen, bis er zum
Stillstand kommt, so besteht doch immer noch die Möglichkeit, dass er
in seinen letzten Monaten oder Jahren das Leben bejahen und der
Zukunft aus der Geborgenheit seines wahren Selbst heraus entgegensehen
kann. Allein um dieses Ziel zu erreichen lohnt sich auch der
hartnäckige „Kampf“.
"Wenn wir nicht mehr heilen können,
dann können wir lindern.
Und wenn wir nicht lindern können,
dann können wir trösten.
Und wenn wir nicht trösten können,
dann sind wir immer noch da."
Stefan Einhorn (b.1955, Molekular Onkologe, Karolinska Institut
Stockholm):
„Die Kunst ein freundlicher Mensch zu sein“ HOFFMANN 2007
Wenn die
Familie aber glaubt, dass der Patient sterben wird, dass es keine
Hoffnung mehr für ihn gibt, dann wird es schwieriger denn je für ihn,
zu hoffen und um sein Leben zu „kämpfen“. Für die Familie ist
„Aufgeben“ natürlich häufig ein
Akt des Selbstschutzes. Es immunisiert die Angehörigen bis zu einem
gewissen Grade gegen die Teilhabe am Leiden des Patienten – die
Familienmitglieder sind dann im-stande, sich zu sagen:
„Es muss ja nun bald zu Ende gehen.“
Aber
eine solche Haltung bleibt dem Patienten nicht lange verborgen und hat
eine unendlich deprimier-ende Wirkung auf ihn.
Wenn die Anderen nicht mehr für ihn
hoffen, warum sollte er dann für sich selbst noch Hoffnung hegen?
Dazu
kommt, dass diese Einstellung natürlich die Überzeugung des Patienten
noch bestätigt, dass er nun einmal nicht liebenswert ist.
Ich habe
im Laufe meiner Tätigkeit mehrmals Veranlassung gehabt, der Familie
eines Krebspatienten zu sagen:
„Wir
müssen den Dingen ins Auge sehen.“
Ein
solcher Satz ist ausgesprochen negativ getönt. Die Familie, die ihn
hört, rechnet damit, dass ich ihn mit den Worten „Joe stirbt“ beenden
werde.
Wenn ich
stattdessen sage: „Joe lebt ja
schließlich noch!“, dann wirkt das auf die Familienmitglieder
wie ein heilsamer Schock: Sie sind aufgerüttelt und erkennen, dass Sie
es waren, die Joe bereits als tot betrachtet haben.
Zurechtweisungen dieser Art müssen auch dann erfolgen,
wenn die Familie dazu neigt, den
Patienten wie ein unmündiges Kind zu behandeln und ihn so jener
Kräfte zu berauben, die er doch braucht, um zu wachsen und sich zu
entfalten.
In
unserer Kultur besteht eine ganz ausgeprägte Neigung, den Patienten
seelisch gewissermaßen in Watte zu wickeln –
ihn nämlich
zum hilflosen Kind zu machen. Das
sollte man nicht zulassen.
Man muss
der Familie begreiflich machen, dass „Ruhe“ keine besonders wirksame
Medikation ist und der Patient von eigenen Aktionen
nicht abgehalten werden
sollte. Natürlich gibt es Krankheiten – wie Tuberkulose oder Hepatitis
-, bei denen seine Aktivität aus medizin-ischen Gründen eingeschränkt
werden muss, aber der Krebs gehört nicht dazu.
Der Patient sollte vielmehr angeregt werden, möglichst viel zu tun und
zu unternehmen und erst dann innezuhalten, wenn er das Gefühl hat, er
werde „vor Erschöpfung gleich umfallen“.
Häufig
sind die Familie und der Arzt der Meinung, dass der Aktivitätspegel
des Patienten so niedrig wie möglich gehalten werden müsse, und
behindern ihn so in seinem Versuch, seinen eigenen Weg zu finden und
sein eigenes Sein zum Ausdruck zu bringen.
Ich habe
es oft für nötig gehalten, mich sehr energisch gegen diese Tendenz zu
wenden.
Ein
weiterer Grund, weshalb man eine Beziehung zur Familie des Patienten
aufbauen sollte, besteht darin, dass man den
Angehörigen helfen muss,
sich realistisch auf die Dinge
einzustellen.
Die
Familie hat ja auf vielen Ebenen ganz reale Probleme, von
auftauchenden finanziellen Schwierig-keiten bis hin zu der Frage, wie
sie mit ihrem Kummer und ihrem Schmerz fertig werden soll, und diese
Probleme sollten besprochen werden, wenn es notwendig ist.
Ein
solches Gespräch mit der Familie wirkt sich oft so aus, dass dem
Patienten damit eine Last von den Schultern genommen wird,
insbesondere wenn er der Hauptverdiener in der Familie ist.
Ein
wichtiges Anliegen des Therapeuten muss es schließlich sein, die
Kinder auf den möglichen Tod des kranken Vaters bzw. der kranken
Mutter vorzubereiten, so dass sie später nicht das Gefühl haben:
„Wenn ich doch nur ein
gehorsameres Kind gewesen wäre – dann hätte meine Mutter mich nicht
verlassen.“
Allein
dieses bedrückende Gefühl kann, wie wir gesehen haben, einen Menschen
zu jener Selbst-verachtung und Furcht vor
engen mitmenschlichen Beziehungen prädestinieren, die
ihrerseits integrale Kennzeichen der krebsanfälligen Persönlichkeit
sind.
Man
sollte die Möglichkeit ganz ernsthaft in Betracht ziehen, dass das
immer neue Auftreten des Krebses in mehreren Generationen der gleichen
Familie mehr mit dieser immer wieder verstärkten gefühlsmäßigen
Belastung zu tun hat als mit den genetischen Gegebenheiten.
Umgekehrt sollte der Therapeut auch die Eltern in der Vorbereitung
ihrer Kinder auf den möglichen Tod des kranken Familienmitgliedes
unterweisen. Es gibt allerdings auch Fälle, in denen er diese wichtige
Aufgabe selbst übernehmen muss. Ich hatte einmal eine schon
bettlägerige Patientin, die ich zweimal in der Woche in ihrer Wohnung
besucht. Sie hatte einen zehnjährigen Sohn, und ihr Mann brachte es
nicht über sich, mit dem Kind über die Krankheit der Mutter zu
sprechen.
Wenn ich
nach der Sitzung aus dem Haus und zu meinem Auto ging, begleitete der
Junge mich oft, und dann unterhielten wir uns noch etwa eine halbe
Stunde über seine Gefühle und Empfindungen. Ich erklärte ihm immer
wieder, dass wir nicht wissen, wodurch der Krebs verursacht wird, dass
wir aber jedenfalls wissen, dass er
nicht durch das Verhalten
anderer Menschen entsteht.
Es war
ganz gleichgültig, so sagte ich dem Jungen, wer er war oder wie er
sich benahm, der Krebs wäre so und so eingetreten. Seine Mutter liebe
ihn sehr und „kämpfe“ hart darum, wieder gesund zu werden, aber wenn
sie nun doch nicht wieder gesund werden würde, so sagte ich ihm
weiter, so könne man das keinesfalls ihm zum Vorwurf machen.*
Oft ist
es notwenig, die Angehörigen – die Kinder und/oder den überlebenden
Partner – noch eine ganze Weile nach dem Tod des Patienten zu
begleiten. Diese Arbeit, mit der verhindert werden soll, dass durch
den Tod des Patienten mehr emotionaler Schaden angerichtet wird, als
absolut unvermeidlich ist, bildet einen ganz selbstverständlichen
Bestandteil der Aufgabe des Therapeuten.
Häufig
bitten die Patienten selbst noch um diese Art der Hilfe, und man kann
ihnen ihre Bitte nicht abschlagen. Wenn dieser Dienst nicht erbeten
wird, sollte man ihn sogar anbieten. Manchmal hat die Familie nicht
mehr so viel Geld, um Besuche dieser Art zu bezahlen – ein Umstand,
den jeder Therapeut, der mit todkranken Patienten arbeitet, im
vorhinein bedenken und akzeptieren muss.
Sehr häufig geht die echte Kommunikation zwischen dem Schwerkranken
und seinen nächsten Angehörigen mit der Zeit verloren.
Die Angehörigen versuchen vielleicht, die Befürchtungen des Patienten
zu zerstreuen, indem sie jedes Gespräch über seine Krankheit von
vornherein vermeiden. Wenn das Thema doch einmal angeschnitten wird,
dann versuchen sie gewöhnlich, so zu tun, als würde der Patient wieder
gesund werden.
Wie wir
gesehen haben, gibt es in der Tat Fälle, in denen es zu einer
Resmission gekommen ist [1] [„Spontanheilung bei Krebs: 1:60.000“].
Aber wenn der Arzt den Angehörigen gesagt hat, dass es keine Hoffnung
mehr gibt, dann glauben sie in der Regel nicht mehr ernsthaft an eine
solche Möglichkeit.
Wenn sie
dann mit dem Patienten tatsächlich einmal über die Möglichkeit seiner
Genesung sprechen, dann sagen sie Dinge, an die sie selbst nicht
glauben, und der Patient erspürt das unweigerlich.
Für den
Patienten ist eine solche Situation ungheuer belastend und verstärkt
sein Gefühl der Verlassenheit
noch weiter. Das Rettungsseil, das Ihn mit den anderen verbunden hat,
ist zerrissen: es gründete auf der absoluten Ehrlichkeit aller
Beteiligten.
Nun
nehmen die Ängste und Befürchtungen des Patienten noch weiter zu. Im
Hinblick auf diese Spirale muss der Therapeut nach Kräften dafür
sorgen, dass dem Patienten möglichst viele Bahnen des offenen und
ehrlichen Austauschs mit anderen zur Verfügung stehen.
Volker Fintelmann:
Lüge und Illusion
>>>
Wie
wichtig diese Ehrlichkeit, nicht
nur zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten, sondern auch
zwischen der Familie und dem kranken Familienmitglied ist, kommt
vielleicht am besten in der folgenden Fallgeschichte zum Ausdruck:
George,
ein Mann von 67 Jahren, litt an Unterleibskrebs und war an sein Bett
im Krankenhaus gefesselt. Er wusste, dass seine Krankheit tödlich war,
aber er hatte Anna, seiner Frau, nicht gesagt, dass er das wusste – er
wollte es ihr „ersparen“.
Nach
außen hin zeigte er sich immer unbekümmert und guter Dinge.
Tatsächlich wusste Anna sehr wohl, dass ihr Mann dem Tode nahe war.
Aber sie verbarg dieses Wissen vor ihm und sagte immer wieder, die
Ärzte hätten ihr versichert, dass er wieder gesund werden würde.
George
und Anna waren seit 42 Jahren verheiratet. Sie liebten einander und
waren sich sehr zugetan, aber sie brachten es nicht fertig, über
dasjenige Thema miteinander zu sprechen, das jeden von ihnen mehr als
alles andere in der Welt beschäftigte.
Da
keiner von ihnen wagte, dieses Thema aufkommen zu lassen, gab es immer
mehr Fragen und Sachverhalte, über die Sie nun auch nicht mehr
miteinander sprechen konnten, weil deren Erörterung das Gespräch unter
Umständen auf das verbotene Thema von Georges wahrscheinlichem Tod
gelenkt hätte.
George
und Anna brauchten einander jetzt mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt
in ihrem gemeinsamen Leben, aber jeder von Ihnen war von der einen
Person völlig abgeschnitten, die ihm am besten hätte helfen könne –
vom Partner.
Anna
verbrachte viel Zeit im Krankenhaus, aber trotz der physischen Nähe
türmte sich eine emotionale Mauer zwischen Ihnen auf, die immer höher
wurde.
„Die Krebskrankheit ist immer
eine Ganzheitskrankheit,
das heißt,
alle Zellbürger des Zellstaates sind direkt oder indirekt betroffen.
Es gehört zu den schlimmsten Irrwegen der Schulmedizin,
die Krebskrankheit wie eine ausschließlich
örtliche Krankheit zu
behandeln.
Dies zeugt von einem völligen Unverständnis biologischer
Zusammenhänge.
Jede primär örtliche Schädigung, mechanischer, thermischer,
radioaktiver oder chemischer Art,
mit Infektion oder ohne, führt nach unterschiedlich langer Latenzzeit
– von wenigen Stunden
bis Tagen –
zu dem, was
medizinisch „Allgemeinreaktion“ genannt wird, und zwar ausnahmslos.
Dies äußert sich in Signalen wie Fieber, Pulsbeschleunigung,
Unwohlsein und anderen Anzeichen.
Heilen kann eine Krankheit nicht der Arzt, sondern nur
die natürliche Heilkraft des Ganzheitsorganismus,
d.h. die Gesamtheit der Selbstheilungskräfte.
Wir Ärzte können bestenfalls heilen helfen
…
Die örtliche Ausschaltung eines Krebsherdes kann nützlich sein, ohne
Frage.
Sie wirkt durch eine Verkleinerung des Krebszellvolumens im Ganzen und
des Streuvolumens.
Mehr geht nicht. Es bleiben immer Reste irgendwo.
Und mit denen müssen die Selbstheilungskräfte (Immunsystem etc.)
fertig werden.
Je mehr diese jedoch durch den örtlichen Eingriff geschädigt werden,
umso kleiner ist die Heilungschance.
In der Verletzung dieser Balance liegt allzu oft die Ursache
schwerster Behandlungsschäden
…"
Prof. Dr. med. Julius Hackethal: „Der Meineid des Hippokrates. Von der
Verschwörung der Ärzte
zur
Selbstbestimmung des Patienten“ BASTEI LÜBBE VERLAG
2. Auflage 1997
Beide
hatten mir gesagt, dass Sie dem anderen gegenüber nicht zugeben
wollten, was Sie wussten.
Meinem
Gefühl nach war dies eine unerträgliche Situation, die Ihnen beiden
wehtun musste, und ich beschloss, etwas zu unternehmen.
Ohne
Vorwarnung und mit ziemlichen Bedenken betrat ich eines Nachmittags
Georges Zimmer, als Anna bei ihm saß, und sagte:
„Es ist Zeit, dass Sie beide
sich einmal darüber unterhalten, was vorgeht. Wie Sie ja beide wissen,
handelt es sich um Krebs, und George ist schwerkrank. Wir sind alle
sehr erschrocken, und die Sache hat ja in der Tat eine erschreckende
Seite. Aber kein Mensch gibt die Hoffnung auf. Wir werden dagegen
„ankämpfen“. Es gibt noch eine Menge anderer Möglichkeiten, die wir
erproben können, und wenn wir sie alle durchprobiert haben, dann
werden wieder neue entdeckt und erfunden. Niemand gibt auf. Wir
versuchen, den „Kampf“ zu gewin-nen, und unsere Chancen stehen nicht
so schlecht. Aber trotzdem ist es gefährlich und erschreckend und
traurig, und es gibt Dinge, über die man ruhig mal ein paar Tränen
vergießen darf. Ich weiß, wie jedem von Ihnen zumute ist, und es ist
Zeit, dass Sie es einander auch wissen lassen. Sie haben sich Ihr
ganzes Leben lang geliebt und einander geholfen, und Sie brauchen
einander auch jetzt.“
Das war
ein dramatischer Schritt, aber im Krankenhaus ist ein solches Vorgehen
recht häufig notwendig. Jeder, der jemals mit todkranken Patienten zu
tun gehabt hat, wird das ohne Zögern bestätigen.
Die
gleiche Notwendigkeit kann natürlich auch außerhalb des Krankenhauses
gegeben sein. Unter anderen als den geschilderten Umständen wäre die
Annäherung zwischen George und Anna vielleicht dadurch bewirkt worden,
dass man mit jedem von ihnen allein gesprochen und dafür gesorgt
hätte, dass sie das offene Gespräch auf ihre eigene Weise eröffnet
hätten. Die Unterredung hätte in meiner Sprechstunde oder in der
Wohnung des Patienten stattfinden könne.
Wo immer
das der Fall ist – ich verlasse anschließend den Raum, aber ich bleibe
erreichbar für den Fall, dass Fragen auftauchen sollten, die ich
vielleicht beantworten kann.
Leider
bestärken Ärzte und Schwestern die Angehörigen häufig noch in dieser
Unaufrichtigkeit, wie sie auch
zwischen George und Anna bestand. Der Grund liegt darin, dass auch
sie, die Ärzte und Schwestern, der Auffassung zuneigen, dass der
Patient
„ja so gut wie tot ist“.
Meine
feste Überzeugung, dass es noch viel zu tun gibt – dass man auch einem
Todkranken zumindest noch dazu verhelfen kann, dass er ein Stück weit
sein wahres Selbst entdeckt, bevor er stirbt, oder dass man ihn, mit
mehr Glück, seinen Lebenswillen, den Glauben an sich selbst
zurückgeben kann, der ihm im „Kmapf“ um sein Leben hilft -, diese
Überzeugung ruft bei den Ärzten unweigerlich gemischte Gefühle auf den
Plan.
Natürlich ist es nicht so, dass der Patient ihnen gleichgültig wäre.
Aber ihre Betrachtung des Krebses als einer Krankheit beruht doch auf
sehr enggefassten Annahmen, die sich nun schon allzu lange einer
breiten Zustimmung erfreuen.
"Die Diagnose stimmt,
aber dem Patienten
fehlt etwas anderes."
Aus: "Die ärztliche Diagnose" Bergmann Verlag 1.Auflage 1917
Richard Hermann Koch
(1882-1949)
Jüdischer Arzt, Medizinhistoriker
Indem man die "Diagnose" zur "Krankheit" erklärt, wird man zum
"Patienten"
und darf - selbst passiv bleibend - Hilfe und Heilung von "Außen",
von einem "Arzt" oder "Therapeuten" erwarten:
Damit wird man der Eigenverantwortung, des eigenen Handelns, der
Selbständigkeit
und schließlich des notwendigen Vertrauens auf die
"Selbstheilungskräfte"
enthoben und beraubt.
Was die
Schwestern angeht, so liegt das
Problem hier wieder etwas anders. Ich habe einmal einen Test an einem
Krankenhaus durchgeführt, um zu sehen, wie lange es dauerte, bis die
Schwestern auf das Klingeln aus den Zimmern der verschiedenen
Patienten reagierten.
Statistisch betrachtet verging vom Augenblick des Klingelzeichens bis
zu ihrem Eintritt in das Zimmer eines todkranken Patienten mehr Zeit
als bis zum Eintritt in das Zimmer eines Patienten, bei dem keine
Todesgefahr bestand. Das ist eine ganz und gar verständliche Reaktion.
Schwestern stehen oft unter erheblichem Druck, und ihre Belastbarkeit
hat – ebenso wie meine oder die irgendeines anderen Menschen – ihre
Grenzen.
Festzuhalten bleibt eines: Der
Krebspatient ist sich völlig im klaren darüber, dass die Schwestern
recht lange brauchen, um zu ihm hereinzkommen. Dieser Umstand
wird nur zu leicht wiederum als Zurück-weisung gewertet und bestärkt
den Patienten in seinen Zweifeln hinsichtlich des eigenen Wertes.
Nachdem
ich meine Untersuchung abgeschlossen hatte, wurden die Schwestern
zusammengerufen und über das Ergebnis unterrichtet. Anfangs bestritten
sie energisch, dass sie sich mit dem Gang ins Zimmer sterbender
Patienten recht viel Zeit gelassen hatten. Aber die Messungen waren
nicht zu widerlegen.
Nachdem
ich erklärt hatte, warum diese „Verspätungen“ mich so interessierten,
kam es zu einer sehr offenen und stellenweise sehr emotionell
geführten Diskussion zwischen den Schwestern und mir.
Sie
sprachen über den Schmerz und die Qualen, die sie angesichts der
häufigen Todesfälle empfanden, und dies um so heftiger, je besser sie
den betreffenden Patienten als Menschen gekannt hatten. Am Ende
versicherten mir mehrer der Schwestern, das sei ein sehr interessantes
Gespräch gewesen, und es sei ihnen nun klar geworden, wie viel ihre
Gegenwart dem Patienten tatsächlich bedeute.
Die Welt
des Krebspatienten kann, obwohl von Schmerz und Trauer geprägt, noch
einmal übergehen in die Welt der Lebenden, und dies selbst bei
Patienten, deren Zustand als hoffnungslos gilt [1].
Gewiss
darf der Therapeut keine falschen Hoffnungen nähren. Dennoch bin ich
fest davon überzeugt, dass das Wort
„hoffnungslos“ aus der Welt des Krebspatienten verbannt werden
sollte und verbannt werden kann. Als Therapeut habe ich die Aufgabe,
dem Patienten dabei zu helfen.
„Krebs
ist
keine
Verurteilung,
es
ist
nur ein Wort“
Dr. med. Bernie Siegel
„Prognose Hoffnung – Liebe, Medizin und Wunder“ ULLSTEIN 2.Auflage
2004 - „Love, Medicine &
Miracles“ 1986
Facharzt für Allgemein- und Kinderchirurgie. Lehrt
an der Yale Universität New Haven – Connecticut
Exceptional Cancer
Patient Group
EcaP
-
"Außergewöhnliche Krebs - Gruppen Patienten"
„Außergewöhnliche Patienten
weigern sich ein "Opfer" zu sein.
Um außergewöhnlich zu sein, braucht man "Mut".
Sie lernen von
anderen, doch sie treffen
Ihre eigenen Entscheidungen.
Sie bemühen sich selbst und riskieren etwas,
und wenn eine
Behandlungsmethode nicht funktioniert,
hören Sie damit auf und
versuchen es mit etwas anderem.
Hoffnung spielt sich im Kopf ab, ist ein psychologischer Vorgang.
Wer die Hoffnung aufgibt, entschließt sich zu sterben.
Wir können
uns selbst und damit auch die Zukunft ändern“
|
 Lawrence
LeShan Lawrence
LeShan
www.healingcancer.info
|
Aus:
Lawrence LeShan (1920-2020, US-Psychologe, Psychotherapeut,
Pionier der psycho-bio-logischen Krebsforschung):
„Psychotherapie gegen Krebs. Über die Bedeutung emotionaler
Faktoren bei der Entstehung und Heilung von Krebs“ Kapitel:
Die Welt der Krebspatienten.
Seite 169 – 186. Klett-Cotta 2001(You Can Fight for Your Life:
Emotional Factors in the Treat-ment of Cancer 1977
*
Außerordentlich hilfreich ist in diesem Zusammenhang ein Buch
von Eda LeShan
[1922-2002]
mit dem Titel „Learning to say Goodbye: When a Parent Dies“
New York Macmillan 1976
|
[Meine
Ergänzungen:
Bilder, Zitate]
Dr. med. Alois Dengg, A-6290 Mayrhofen, Hollenzen 100:
www.draloisdengg.at
[1]
Herbert Kappauf: „Wunder sind möglich – Spontanheilungen bei Krebs“
(1:60.000) HERDER 2003
Paul C. Roud (US Psychologe, Arzt):
„Diagnose: Unheilbar, Therapie: Weiterleben“ – Zwölf Geschichten von
Menschen, die als unheilbar galten. Die Geschichte ihrer Heilung
zeigt: Wunder sind kein Zufall (Making Miracles.
An Exploration into the Dynamics Of Self- Healing, Warner Books 1990)
KREUZ VERLAG 1992
Helm
Stierlin (1926- , Prof.em.,Dr. med et phil), Ronald Grossarth Maticek
(1940- ,Dr.phil, Dr.med.): “Krebsrisiken – Überlebenschancen – Wie
Körper, Seele und soziale Umwelt zusammenwirken” CARL AUER 3. Auflage
2006 (1998)
Ronald Grossarth Maticek (1940- ,Dr.phil et
Dr.med., Medizinsoziologe): „Krankheit als Biographie. Ein
medizinsoziologisches Modell der Entstehung und Therapie der
Krebserkrankung“ KIEPENHEUER & WITSCH 1979
Gerald
Pohler(b.1953, Dr.phil, Wien): „Krebs und seelischer Konflikt -
Psychosoziale Krebsforschung“ NEXUS 1989
Andrew Weil:
„Spontanheilung – Die Heilung kommt von innen“ C. BERTELSMANN 1995
Rüdiger Dahlke (b.1951, dtsch. Arzt, Psychotherapeut): „Krankheit
als Sprache der Seele - Be-Deutung und Chance der Krankheitsbilder“
BERTELSMANN 9.Auflage 1992, u. Taschenbuchausgabe 2008
Elida Evans (US-Psychologin aus der Jungschen Schule): “A
Psychological Study of Cancer“ Dodd, Mead and Company 1926
Bernie Siegel (FA für Allgemein- und Kinderchirurgie USA): „Prognose
Hoffnung – Liebe, Medizin und Wunder“ (Love, Medicine & Miracles 1986)
ULLSTEIN 2.Auflage 2004 (1988 Econ Verlag)
Josef Issels
(1907-1998): "Mein Kampf gegen den Krebs - Erinnerungen eines Arztes"
Ullstein Sachbuch 1983 (1981)
Josef
Issels war ein bedeutender deutscher Arzt, - wirkte in der
"Ringbergklinik" (bis 1973) in Rottach-Egern am Tegernsee und von Ende
1976 bis Ende 1979 in der "Klinik für Ganzheitsmedizin GmbH" in Bad
Wiessee am Tegernsee - der durch eine von ihm entwickelte
komplementär-medizinische Krebstherapie - „Die Ganzheitliche interne
Krebstherapie“ - Issels-Therapie, bekannt wurde und dadurch weltweit
eine große Kontroverse unter Ärzten und Medizinern auslöste.
Prof. Dr. med. Julius Hackethal (1921-1997): „Der Meineid des
Hippokrates. Von der Verschwörung der Ärzte zur Selbstbestimmung des
Patienten“ BASTEI LÜBBE VERLAG 2. Auflage 1997
Julis Hackethal
promovierte
1945 und wurde 1950 Facharzt für Chirurgie. Habilitation 1955/56. Von
1956 bis 1964 Oberarzt an der chirurgischen Universitätsklinik
Erlangen/ Nürnberg. 1962 Ernennung zum Professor. 1965 bis 1974
Chefarzt des Städtischen Krankenhauses Lauenburg/Elbe; danach – bis
1981 – eigene Praxisklinik für Chirurgie. 1981 bis 1988 Regiearzt des
EUBIOS - Zentrum am Chiemsee und seit 1989 eigene EUBIOS – Gutspark
Klinik für Ganzheitsmedizin und ausgewählte Chirurgie in
Riedering/Spreng (Rosenheimer Land).
EUBIOS
(gr. eu = gut, wohl, gehörig, recht, insbesondere aber glücklich,
Glück verheißend, Glück bringend, gr. bios = Leben, Lebensweise,
Lebensart) ist eine eigene Wortkombination, die Hackethal erstmal
1978 in seinem Buch
„Keine Angst vor Krebs“ zur Abgrenzung seines
Konzeptes für ein Behutsames bzw. Sanftes Krebs Bekämpfungsprogramm
gegenüber der orthodoxen Schulmedizin benutz hat.
Später wurde EUBIOS zum Markenzeichen für sein Gesundheitsprogramm mit
folgenden Zielen:
Bestmögliche Gesundheitshilfe für ein möglichst glückliches Leben des
Patienten – nicht aber zu einem Leben um jeden Preis – nach seinem
höchstpersönlichen Wunschwohl und unter seiner Therapiehoheit. Und auf
Seiten des Arztes mit dem "EUBIOS –Humanitas – Gelöbnis" und den
Regeln der Ganzheitsmedizinwissenschaft als Gesetz für eine
Berufsausübung „von Freund zu Freund“.
Die EUBIOS - Gesundheitshilfe ist also weder eine Antischulmedizin
noch eine Alternativmedizin, sondern eine Mischung aus moderner
Schulmedizin und einer Vielzahl anderer Gesundheitshilfen, die sich
stellvertretend oder ergänzend bewährt haben
Stefan
Einhorn (b.1955, Prof., Molekular Onkologe Karolinska Institut
Stockholm): „Die Kunst ein freundlicher Mensch zu sein“ HOFFMANN&CAMPE
2007 (Konsten att vara snäll“ 2005)
Siehe ZITATE:
Karl Kraus / Wie es einer Patientin oder einem Patienten wirklich geht
>>>
Hans U. Niemitz / Gutachten Hamer's Neue Medizin
>>>
Karl Popper / Über die Zukunft >>>
Pierre Franckh /
Wie reagiert unser Resonanzfeld
>>>
Julius Hackethal / Die Krebskrankheit
>>>
Bernie Siegel /Der menschliche Geist
>>>
Wilhelm Reich / Die Krebsgeschwulst
>>>
Elida Evans / Krebs
>>>
Alexander Solschenizyn / Krebsstation
>>>
In Memoriam Josef Issels / Ganzheitliche
Krebstherapie >>>
Werner Schneyder / Krebs -
Eine Nacherzählung
>>>
Volker Fintelmann / Lüge und Illusion
>>>
Frederic Chopin / In mir klingt ein Lied
>>>
David Servan Schreiber / Der Angst
die Spitze nehmen
>>>
Asmus Finzen/ Warum werden unsere Kranken wieder gesund?
>>>
Siehe INFOS:
Info für Ratsuchende / Die Illusion der Gewissheit
>>>
Denkrahmen der Logik
>>>
Statistik
Glossar & Allerlei
>>>
Siehe LEISTUNGEN:
Palliativmedizin
>>>
Additive Krebstherapie >>>
Meine "unvollständige"
Literaturliste
>>>

