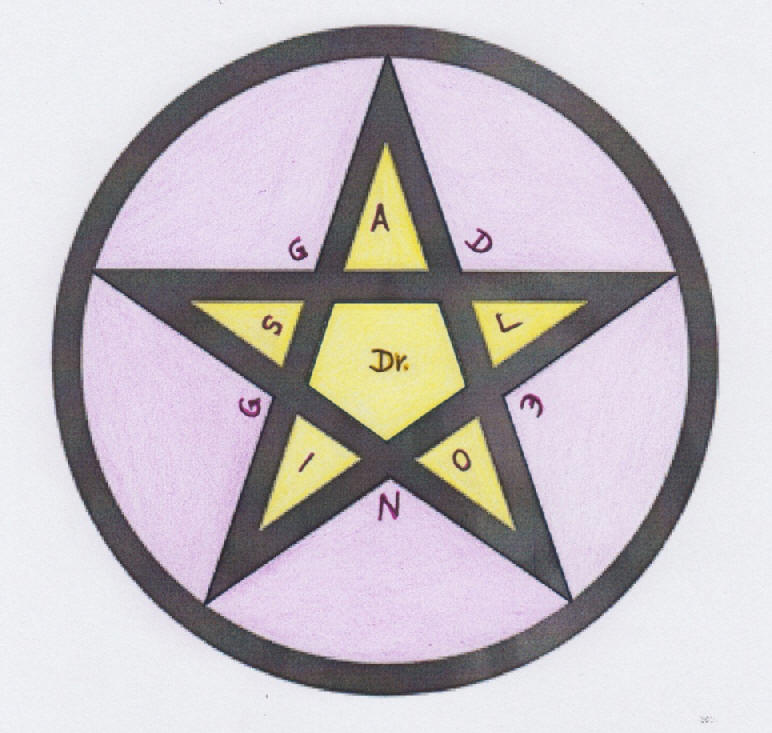
„Der
Beruf des Arztes
macht eine Hinwendung von Mensch zu Mensch
erforderlich.
Der Arzt muss sich grundsätzlich bemühen, den Patienten als ein anderes Ich,
als Person zu akzeptieren.
Er darf ihn nicht ausschließlich als ein reparaturbedürftiges Etwas ansehen,
sonst läuft er Gefahr,
einem Automechaniker, oder bestenfalls einem Tierarzt, im
günstigeren Fall noch einem Erfüllungsgehilfen
der Krankenkasse gleichgestellt
zu werden.
Die Fülle an medizinischem Wissen und Können belastet den heutigen
Arzt in einer Weise,
die einer intensiveren Beschäftigung mit den theoretischen
(philosophischen) Grundlagen des Menschseins
kaum mehr Zeit lassen.
Philosophieren erscheint als entbehrlich oder sogar als belächelnswert.
Auch die
Ausweitung der medizinischen Lehre auf die Gebiete der Psychosomatik und der
Sozialmedizin
haben diesbezüglich keinen Fortschritt gebracht.
Eine fundierte
Medizinethik steckt mangels einer tragfähigen allgemeinen
Wissenschaftstheorie der Medizin
in den Kinderschuhen. Die
naturwissenschaftliche Methodik beherrscht derzeit mit geringen Ausnahmen
das
medizinisch-wissenschaftliche Terrain. In dieser Methodik ist in der Medizin
mangels anderer exakter Methoden
die Statistik als Probabilisierung [1] führend.
[(1)
zunehmender Einfluss der
Wahrscheinlichkeit, „Verwahrscheinlichung“]
Alles, was in der Diagnostik und Therapie geschieht, wird nach einer
Erfolgswahrscheinlichkeit in einem anonymen,
mehr oder weniger äqualen [2]
Kollektiv beurteilt und der erfolglos behandelte
Einzelfall gilt dann als statistischer Ausreißer
oder als nicht repräsentativ.
[(2)gleich
groß, nicht verschieden]
Auch wenn, wie das heute meistens der Fall ist,
die Auswahl der Gruppen
und
Kontrollgruppen, Planung, Durchführung
und Beurteilung nach sorgfältigen
Kriterien erfolgen, so zeigt eine jahrzehntelange klinische Erfahrung, dass
Studien
längst nicht das bringen, was sie zu versprechen scheinen.
Erst jahrelange klinische Erprobung und Bewertung in der Praxis
machen ein
Medikament
zu dem, was es letztendlich zu bieten vermag.
Klinische Studien sind
in Phase 1-3 wohl geeignet, etwas über die Verträglichkeit eines Medikamentes
auszusagen,
die Erfolgsstatistik geht aber meist nicht eindeutig darüber hinaus,
als dass ein Medikament auch nicht entscheidend besser ist
als seine Vorläufer.
Das gilt z.B. eindeutig für die antibakterielle Chemotherapie.
Um dieser
bedrohlichen Entwicklung einer unkritischen Probabilisierung Einhalt zu gebieten, haben wir mit dem dialogischen
Denken
Martin Bubers
(1878-1965, österreichisch-israelischer jüdischer Religionsphilosoph)
den Ausgangspunkt einer neuen Medizintheorie zusammen mit
einer Erweiterung durch die
konstruktivistischen Ideen von Francisco Varela
(1946-2002, chilenischer
Biologe, Philosoph und Neurowissenschaftler, der,
mit Humberto Maturana
(1928-2021, chil. Biologe) Autopoiese Konzept (1972) begründet)
aus der
Heinz von Foerster
(1911-2002,österreichischer Physiker,
Professor für Biophysik, Mitbegründer der
kybernetischen Wissenschaft)
Schule vorgeschlagen.
Der Versuch, in
Anlehnung an das Ich-Du und seinem Zwischen nach Martin Buber gegenüber einem
Ich-Es
in zwei Ebenen
(Meta- und Orthoebene) konstruktiv darzustellen, machte
insofern besondere Schwierigkeiten,
als der Übergang von einer an Raum,
Zeit und
Kausalität gebundenen Orthoebene zu einer dimensions- und kategorienlosen
Metaebene schwierig ist und als ein Rückfall
in die angeblich längst totgesagte
Metaphysik oder als Mystik angesehen wird.
„Die Lösung des Rätsels des Lebens
in Raum und Zeit liegt außerhalb von Raum und Zeit“,
betont selbst
Wittgenstein
(Ludwig W. 1889-1951
österreichisch-britischer Philosoph).
Durch eine strikte Ablehnung jedes metaphysischen Gedankenganges, der über die
in der Naturwissenschaft geforderte Messbarkeit
hinausgeht, gefährdet man aber
die Existenz des Subjekts, und das macht das Arzt-Patient-Verhältnis lediglich
zu einem Dienstvertrag,
wenn nicht gar zu einem Werksvertrag womöglich
noch mit Erfolgsgarantie und ihrem Werbeslogan: bei Misserfolg, Geld zurück.
Beim Arzt-Patient-Verhältnis handelt es sich nicht nur um ein Subjekt,
sondern
um
ein Verhältnis von zwei Subjekten als autonome Personen.
Diese Intersubjektivität zwischen Arzt und Patient ist von besonderer Art.
Sie
widersteht jeder Messung, ist akausal und ist daher von jeder
naturwissenschaftlich betriebenen Psychologie
und Soziologie niemals zu
erfassen. Schon deswegen, weil sie nicht der klassischen Logik allein gehorcht
und sich damit in ihrer Vollständigkeit dem anerkannten, auf Induktion [3]
beruhenden Wissenschaftsbegriff entzieht.
[(3) Als Induktion (lateinisch inductio, „Hineinführen“)
bezeichnet man im schlussfolgernden Denken die Zusammenfassung von
Einzelphänomenen
(z. B. Beobachtungen, Daten) in einem allgemeineren Satz und
somit die wichtigste Form der reduktiven Schlussweise.
In einem erweiterten Sinn
umfasst der Begriff alle Arten von vermuteten Gesetzmäßigkeiten]
Dieses intersubjektive Verhältnis geht weder
nur von einem isolierten Subjekt aus, wie das Schütz
(Alfred Sch. 1899-1959, österr.
Jurist, Philosoph und Soziologe, Begründer der phänomenologischen Soziologie) beschreibt,
noch von der Gesellschaft, wie es Mead
(George Herbert Mead, 1863-1931,
Professor für Philosophie und Sozialpsychologie
an der Universität Chicago)
vorschlägt, sondern viel überzeugender nach Buber
(Martin B.)
vom
Zwischen der Beziehung zweier
autonomer Subjekte.
„Ich verstehe ein
bisschen von der Natur und kaum etwas vom Menschen“,
sagte Einstein (Albert E. 1879-1955, Nobelpreis f. Physik 1921)
bescheiden,
doch
das Subjekt war ihm stets heilig und er
bezeichnete es als kaum zugänglich.
Den kranken Menschen sah er aus
eigener Erfahrung heraus als kreativ an. „Die Krankheit“, sagte er,
„hat ihre Vorteile,
man lernt denken“. In einem längeren Gespräch mit Martin
Buber, der Einstein nach seinem Glauben fragte, erklärt dieser:
„Was wir
[die Physiker] erstreben, ist, Seinen [Gottes] Plan nachzuzeichnen, so
wie man eine geometrische Linie
[more geometrico nachBaruch de
Spinoza,
1632-1677, niederländischer Philosoph] nachfährt“.
So machte
er den Konstruktivisten Mut, denn Einstein hielt alle seine Erkenntnisse für
das Wissen von Schulkindern ... und
die wahre Natur der Dinge, die werden wir
nie, nie erkennen. Trotzdem ging es Einstein nicht nur um den Willen zum
Wissen,
sondern vor allem auch um den Willen zur Wahrheit.
Sein
berühmtester philosophischer Ausspruch ist:
„Gott würfelt nicht!“.
Allerdings wird diese Feststellung heute von
vielen modernen Physikern, wie z.B. von Stephen Hawking
(b. 1942, englischer
Astrophysiker, 1963 wurde bei Hawking Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
diagnostiziert,
seit 1968 ist er auf einen Rollstuhl angewiesen), wohl aus Missverstehen,
was Einstein
ausdrücken wollte, strikt abgelehnt.
Wenn Physiker,
wie Einstein und auch Hawking erstreben, Gottes Plan nachzuzeichnen, warum sollte
das für die Mediziner
nicht
genau so erstrebenswert sein? Der Arzt muss sich
noch mehr als der Physiker bemühen, in die Nähe von „Gottes Plan“
zu kommen, umso mehr als es sich beim Patienten nicht nur um einen Partner oder gar um eine
Ware handelt,
sondern um einen autonomen Mitmenschen als Abbild des gemeinsamen
Schöpfers.
Doch des Anderen als eines anderen Ichs (nach Pythagoras
von Samos, 570-510 v.Chr)
im Sinne Bubers
inne-zu-werden, bedarf es einiger Bemühungen.
In der modernen
Existenzphilosophie (Edmund
Husserl
1859-1939,
Jean-Paul
Sartre
1905-80,
Martin
Heidegger
1889-1976
u.a) geht es kaum
um dieses Bemühen, doch spielt das Geschehen
einer „Veränderung“ eine wichtige Rolle, das soll heißen, in einer
engeren Kommunikation
(wie sie zwischen Arzt und Patient stets stattfinden
sollte) findet stets eine Veränderung des jeweils Anderen durch gegenseitige
Beeinflussung statt.
Der Mensch sieht im Anderen zuerst immer nur das Objekt,
die Materie. Das führt im Sinne einer Veränderung vorerst zu einer Entfremdung,
die von
Sartre als Konfliktursache gedeutet wird. Zur Überwindung
dieses Auseinanderklaffens zweier Personen schlägt
Peter Kampits
[b.1942, Philosoph, Wien]
einen „Sprung“
vor, um auf den „Boden zu gelangen, auf dem sich dialogisches Denken
entfaltet“.
Was soll dieser Sprung? Sartre denkt ausschließlich an
das, was sich im Ich selbst abspielt und schließt damit
die Position des anderen
als eine Antwort auf einen Anruf weitgehend aus.
Der Patient ist
ein Hilfesuchender und ruft diesbezüglich den Arzt an.
Der Arzt
muss sich seine Antwort wohl überlegen und sich darüber im klaren sein,
dass er mit dieser den Patienten verändern kann. Der Patient sagt: „Mir fehlt etwas“.
Der Arzt soll ihm suchen helfen, was das ist und
wo das ist
und sei es, dass ihm
seine Seele entfleucht ist, die es nun in
Schamanenmanier
aus Himmel und Hölle zurückzuholen gilt.
Schon Rufus
von Ephesus
(um 100 n. Chr., Arzt u. Schriftsteller)
aus der alexandrinischen Schule meinte,
dass der Arzt mehr auf
sich achten solle, wie der Patient etwas sagt
und weniger auf das, was er
versucht mitzuteilen.
Solch eine
Betrachtung des Patienten geht über eine Beobachtung des Details
hinaus
und soll in einen Versuch des Innewerdens des Patienten münden.
Die
Beobachtung
ist ein aufmerksames Hinschauen auf Details, auf ein
Symptom,
z.B. auf eine eventuelle Gelbfärbung der Skleren oder ein Exanthem
oder
eine Schmerzreaktion etc.
Die
Betrachtung
breitet solche beobachtete
Symptome über den ganzen Körper aus.
Der Arzt betrachtet dann den Patienten wie
ein Künstler, der sein Gegenüber porträtieren will.
Er verwandelt den Eindruck,
vielleicht schon gestalthaft, in ein Krankheitsbild.
Das
Innewerden
aber ist das Erfassen der Persönlichkeit des Patienten
als gleichwertigen
Partner, als Ganzes, als autonome Person.
Buber bezeichnet dieses
Innewerden als Möglichkeitsgrenze des Dialogischen überhaupt.
Das
Verändern und die daraus folgende Unterscheidung des Menschen von sich
selbst
sind
viel besprochene Probleme der Philosophie und Psychologie. In
beiden Situationen ist es
das Gegenüber des Menschen, das ihn in diesem Sinne
formen kann.
Solch eine Transformation mag auch das Innewerden sein.
Doch
soll das Innewerden die beiden Personen des Arztes und des Patienten
so
verbinden, dass ein gestalthaftes Zwischen entsteht.
Dabei wird eine
Begegnung in eine Beziehung verwandelt.
Während die Begegnung in
einer Orthoebene im Sinne eines Verhältnisses eines Ich zu einem Es
stattfindet,
in der Befunde erhoben und beurteilt werden, erfolgt die Beziehung
in einer Metaebene im Sinne eines autonomen Ich
zu einem autonomen Du,
die ein neues autonomes Zwischen erscheinen lassen.
Die Ich-Es-Begegnung
findet
in Raum,
Zeit und Kausalität statt, die Ich-Du-Beziehung hat ihr Wesen außerhalb
aller sinnlichen und intellektuellen Koordination.
Aufgrund der
Inkommensurabilität
(„Unmessbarkeit“, nicht zusammen messbar)
einer Ortho- und Metaebene kann eine direkte Verbindung
nicht
hergestellt werden. Es müssen „Kräfte“ angenommen werden, die eine gegenseitige
Beeinflussung zwischen den beiden
an sich inkommensurablen Ebenen möglich
machen.
Die Existenz solcher Transformationsenergien wird immer dann angenommen,
wenn der Versuch unternommen
wird,
eine gegenseitige Beeinflussung von
qualitativen und quantitativen Eigenschaften zu erklären.
Frühe diesbezügliche
Bemühungen finden sich bereits im alten Testament, Im Hohelied sowie in der
daraus hervorgegangenen Kabbala
(die mystische Tradition des Judentums),
in den indischen Chakras
(„Energiekanäle, -zentren“),
und setzen sich in der christlichen
mystischen Tradition
wie z.B. auch in der
Benediktinerregel des „Ora et labora“
(Bete und arbeite) fort.
Das Ora, die
Aufforderung des heiligen Benedikt von Nursia
(480 - 547, Begründer des
christlichen Mönchtums im Westen)
als verpflichtendes Gebet,
ist eng verwoben mit dem
ebenso verpflichtenden Labora, der Arbeit. Im Ora liegt der Sinn und das Ziel
der Arbeit. „Was ihr dem Mitmenschen
getan habt, habt ihr mir getan“,
sagte Christus. Das gilt für die Benediktinermönche in der Krankenpflege, in der
Sorge für die Armen und
Gebrechlichen, im Schulunterricht, aber auch für die
Vermehrung des Wissens durch die Anlage von Bibliotheken, Übersetzungen und
Herstellung
von Schriften, in der Errichtung von Bauten und der Schaffung von
Kunstwerken. Aus der Abwendung von einer ausschließlichen Kontemplation
(„beschauliche Betrachtung“) zu einem Dienst an der Menschheit zur
höheren Ehre Gottes ergibt sich eine liberalere tolerantere Haltung gegenüber
der produktiven Arbeit der gläubigen, andersgläubigen oder auch nichtgläubigen
Mitmenschen. Die Bedeutung der Benediktiner und der aus ihnen
hervorgegangenen
Orden für den hohen Wissensstand Europas und dementsprechend auch für die
Medizin kann gar nicht hoch genug
angesetzt werden. Wir stehen vor dem Zeitpunkt
des Einstiegs in das einundzwanzigste Jahrhundert.
Ein Rückblick auf vergangene
Jahrhundertwenden mag deutlich machen, wie wandlungsfähig das Kulturbewusstsein
und damit auch die Auffassung von der Medizin im Lauf der Zeit sind. Die Medizin
war und ist immer
in die gesamte Kulturentwicklung eingebettet, auf die sie dann
selbst wieder zurückwirkt.
Wir registrieren
schon in der Wende zum 11. Jahrhundert die Gründung der Ärzteschule in
universitärem Rahmen in Salerno
(Salernitaner Arzt
Archimatthaeus im 10.Jhd.).
Die bis dahin fast ausschließlich von Benediktinermönchen betriebene, rein
empirische Mönchsmedizin
sollte eine wissenschaftliche Grundlage erhalten.
Übersetzungen der Werke anerkannter
antiker griechischer, römischer und
arabischer Ärzte
bildeten die Unterlagen für das berühmte Salernitische
Lehrgedicht
mit seinen 4000 Versen, von denen leider nur 400 erhalten geblieben
sind.
Aus:
„Klinische Philosophie - Teil4: Ärztliche Hodegetik – Wege zu einer partnerschaftlichen Medizin"
Einleitung, Seite 7-11.
VERLAG WILHELM MAUDRICH 2000
„Klinische Philosophie":
Teil 1: Ärztliche Dialogik 1995
Teil 2: Ärztliche Ethik 1995
Teil 3: Ärztliche Wissenschaft 1998
Teil 4: Ärztliche Hodegetik 2000
VERLAG WILHELM MAUDRICH

Prof. Dr.med. Karl Hermann Spitzy
(1915 - 2013)
Prof. Dr. med. et phil. Mag. artium
Österreichischer Mediziner, Philosoph
Onkologe Wien
Er erlangte international hohe Bekanntheit
durch seine Penicillin-Forschungen
(Oralpenicillin, Penicillin-Hochdosistherapie)
[Meine
Ergänzungen]
Hodegetik
(Hodegese,
griechisch der Weg, vgl. auch Hodegetria) bedeutet wörtlich die Lehre von der
Wegweisung.
Eine pädagogische Methode zur Erlernung des richtigen Verhaltens
z.B. des Arztes
gegenüber dem Patienten.
Ihren
Ursprung hat dieses Fach in der ärztlichen Hodegetik, einer schon im Mittelalter
gelehrten Disziplin des Medizistudiums,
die den richtigen
Umgang des Arztes
mit Patienten vermittelte. Als historischer Fachbegriff
aus der Pädagogik
ist damit im wesentlichen die Lehre von der Anleitung zum
Universitätsstudium gemeint.
Aufgabe der Hodegetik
ist es, „Sinn und Zweck des
akademischen Studiums sowie seine Methode“ (Horst Kunze) zu vermitteln.
Karl Hermann Spitzy wurde am 10.
November 1915 als Sohn des Wiener Orthopäden Hans Spitzy [1872-1956] geboren.
1933 begann er nach der Matura am Wiener Schottengymnasium ein
Philosophiestudium, wechselte aber zur Medizin, wo er 1939 promoviert wurde.
Nebenbei hatte er aus Existenzsorgen im Jahr 1935 die "technische
Werkmeisterprüfung" abgelegt. Den Krieg verbrachte Spitzy, der Mitglied der
Waffen-SS war, als Arzt in Russland. Via Hannover kam er 1946 an die I.
Medizinische Universitätsklinik in Wien.
Wenige
Jahre später wurde Spitzy durch seine Arbeiten weltbekannt. Bei der Biochemie
Kundl hatten im Jahr 1951 Ernst Brandl [1919-1997], Hans Margreiter [1923-1968]
und Kollegen das erste "säurefeste" Penicillin gefunden. Bis dahin hatte es bloß
das injizierbare Penicillin G (Benzylpenicillin) gegeben. Säurefestes Penicillin
V (V für "vertraulich", später für "Victory") war die Voraussetzung für die Gabe
des Antibiotikums in Tablettenform, da sonst die Magensäure die Substanz
zerstört.
"Penicillin ist so toxisch wie
Staubzucker"
Spitzy wurde von den Tiroler
Wissenschaftern angesprochen, das Penicillin V an den ersten Patienten zu
erproben. 1955 publizierte der Wiener dann die wohl berühmteste seiner rund 300
wissenschaftlichen Arbeiten: "Die perorale Penicillintherapie". Mit dem Präparat
wurde auch der Grundstein für die rasante Entwicklung von halbsynthetischen und
synthetischen Antibiotika gelegt.
Nach der
Entwicklung der Penicillin-Tabletten bewies Spitzy (1962: "Penicillin in hohen
Dosen"), dass man durch entsprechende Mengen des Antibiotikums auch schwerste
Infektionen in den Griff bekommen kann - was ihm prompt den Kosenamen
"Millionenspitzy" eintrug. "Penicillin ist so toxisch wie Staubzucker", predigte
er in Anlehnung an die Wortes eines seiner Lehrer. Spitzy organisierte Hunderte
Kongresse zum Thema der Antibiotika-Therapie. Er wurde mit der Billroth-Medaille
(1993), dem Wilhelm-Exner-Preis (1992) und vielen anderen Auszeichnungen
bedacht.
Spätes Philosophie-Studium
1970 gründete der Arzt und Wissenschafter eine
selbstständige Lehrkanzel für Chemotherapie und wurde 1973 ordentlicher
Professor. 1979 wurde aus der Lehrkanzel die "Universitätsklinik für
Chemotherapie" in Wien.
1987 erfolgte Spitzys
Emeritierung. Unmittelbar darauf nahm er sein Philosophiestudium wieder auf und
promovierte 1994 zum Dr. phil. an der Universität Wien. Titel seiner
Dissertation: "Dämon und Hoffnung". Im Wiener Maudrich-Verlag wurden auch seine
philosophische Werke veröffentlicht (etwa "Ich und Du in der Medizin", "Dämon
und Hoffnung" sowie zwei Bände seiner "Klinischen Philosophie").
Bild und Text aus: APA/red,
derStandard.at, 4.6.2013. http://derstandard.at/1369362546828/Penicillin-Forscher-Karl-Spitzy-gestorben;
[meine Ergänzungen]
